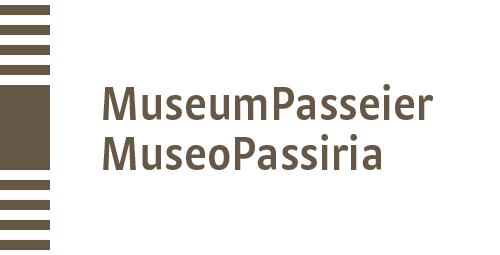Ida erzählt zur Kinderwiege
Bemalte Kufenwiege, datiert 1876, vom Untersteinerhof in Pfelders, Gemeinde Moos. Inv.Nr.: 2000_128
“Sii hattn mii lai gsollt pa di Kinder låssn...”
Von Daniel Hofer.
Die Kinderwiege ist Teil der Sammlungsausstellung “Türen in die Vergangenheit”. Sie ist ein Maturaprojekt und wurde kuratiert und gestaltet von Daniel Hofer, Sandra Fahrner und Alexa Pöhl.
Diese alte Kinderwiege aus dem Jahr 1876 ist mehr als nur ein Möbelstück – sie ist eine Zeitzeugin. Ihr Holz zeugt von unzähligen Momenten, in denen kleine Kinder in ihren ersten Schlaf gehüllt wurden. Wie viele waren es wohl? Wie viele Kinder haben etwa vom Jahr 1876 bis zum letzten Gebrauch in dieser Wiege geschlafen? Viele Kinder, die später selbst ihre Kinder in diese Wiege legten. Viele, die vielleicht nicht das Kindesalter überlebten. Doch all diese Geschichten verweben sich in den Holzfasern dieser Wiege.
Ida Gufler, Hitter Iide, ist Jahrgang 1939 und lebt im Haus St. Benedikt in St. Martin. Foto: Sandra Fahrner.
Ida Gufler erinnert sich an die Geburten bei ihr Zuhause. Ihre Mutter hatte mehrere Frühgeburten. Da sie bei den Geburten sehr litt, mussten die Kinder das Haus verlassen und in den Wald gehen. Bei einer Geburt bei ihnen zu Hause waren stets eine Hebamme, ein Arzt und ein Pfarrer anwesend: „Der Pfarrer kam immer mit, damit jemand da war, falls sie sterben würde, denn ihr ging es wirklich schlecht. Ins Krankenhaus gehen hätte man selbst bezahlen müssen, deswegen blieb meine Mutter bei ihren Geburten immer zu Hause.“
Woher das Kind kam, war keine Frage. „Es hieß immer, ein Vogel hätte es gebracht oder es sei aus an fauln Stock [aus einem morschen Baumstrunk] herausgekommen.“ Nach der Geburt musste die Mutter acht Tage lang ruhen und sich dann vom Pfarrer ausseegnin låssn [den Segen geben lassen], bevor sie wieder in die Kirche gehen durfte. „Da musste man vor der Kirche niederknien, und der Pfarrer hat dann die „bösen Geister“ vertrieben. Erst danach durfte man wieder in die Kirche und wurde vom Pfarrer mit Weihwasser gesegnet.“, erzählt sie. Mütter wurden in dieser Zeit als „unrein“ bezeichnet.
Ida erzählt weiter. „Die Kinder wurden nur etwa einen Monat gestillt, weil die Mütter auf dem Hof arbeiten mussten. Ab einem halben Jahr setzten wir die Kinder in eine Staige [Apfelkiste aus Holz] und nahmen sie bei der Heuarbeit und anderem mit.“ Als Idas Schwiegermutter einmal auf ihr Kind aufpasste, gab es einen schmerzlichen Moment. „Bei mir war die Schwiegermutter zuhause und die hatte das Wort. Sie sagte, ich solle raus arbeiten gehen und sie schaue auf die Kinder. Einmal bin ich ins Haus gegangen, um das Kind zu stillen. Da habe ich die Schwiegermutter schreien gehört: „Du sacklere Fråtze [verfluchtes Balg], i schloog di grood niider, wenn du sou schraisch!“ Das hat mir weh getan. Sie hätten nur mich sollen bei den Kindern zuhause bleiben lassen. Aber wenn man den Frieden haben wollte, musste man still sein. Die Schwiegertochter war sowieso immer der „böse Geist“.“
Sammlungsausstellung
TÜREN IN DIE VERGANGENHEIT
12.4. – 31.10.2025
Maturaprojekt von Daniel Hofer
Grafik, Konzeption, Interviews: Daniel Hofer, Alexa Pöhl, Sandra Fahrner
Beratung: Manfred Schwarz, Judith Schwarz
Texte: Daniel Hofer
Fotografie: Sandra Fahrner, Alexa Pöhl, Milena Haller
Zeitzeug*innen: Schwester Annunziata Maria, Luise Gögele, Anton Gufler, Ida Gufler, Regina Öttl, Martina Platter, Christine Platter, Helmut Platter
Abbau und Montage: Florian Öttl, Wolfram Hofer, Hannes Spöttl, Sandra Fahrner, Alexa Pöhl, Milena Haller, Daniel Hofer
Finanzielle Unterstützung: Bildungsausschuss St. Martin, Bildungsausschuss St. Leonhard